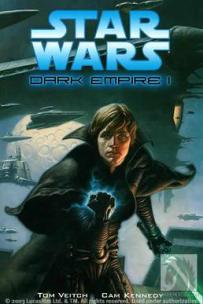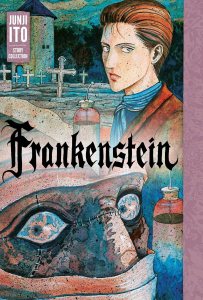
Junji Ito gibt sich nicht allzu viel Mühe, die diversen Einflüsse auf seine Mangas, von klassischen japanischen Geistergeschichten bis hin zu den Werken Lovecrafts, zu verschleiern – meines Wissens nach adaptiert er allerdings selten direkt Werke anderer Autoren. Eine der Ausnahmen ist ausgerechnet Mary Shelleys Roman „Frankenstein“, den Ito zumindest vergleichsweise vorlagengetreu umsetzte – jedenfalls deutlich vorlagengetreuer als die meisten Filme es tun. 2019 erhielt für dieses Werk sogar einen Eisner Award. Gerade im Hinblick auf Junji Itos restliches Œuvre ist sein „Frankenstein“ ein relativ interessanter Ausreißer, gerade wegen der Werktreue. Es wäre sicher möglich gewesen, Shelleys Geschichte stärker an die Sensibilitäten des Mangakas anzugleichen. Für gewöhnlich spielen Itos Geschichten im modernen Japan, was schon zu einer deutlichen Diskrepanz führt, denn Ito behält Zeit und Ort des Romans bei, sprich: Europa im frühen 19. Jahrhundert. Eine weitere Diskrepanz findet sich in der Konzeption: Junji Itos Protagonisten sind zumeist sehr passiv und haben selten eine Agenda, ihnen passieren Dinge. Victor Frankenstein hingegen ist alleiniger Auslöser der Ereignisse, sein Drang, Leben zu erschaffen, setzt sämtliche Begebenheiten in Gang.
Im Großen und Ganzen folgt Ito Mary Shelleys Geschichte ziemlich genau und beginnt ebenfalls mit der Rahmenhandlung auf Captain Waltons Schiff. Frankenstein wird halbtot gefunden und erzählt dem Captain seine Geschichte, angefangen bei der Kindheit in Genf über den Tod der Mutter, die Beziehung zu Elisabeth, Henry Clerval, Justine Moritz und William bis hin zum Studium in Ingolstadt unter Professor Waldman. Es folgt das Bedürfnis, Leben zu erschaffen, der tatsächliche Vorgang und das Erwachen der Kreatur. Anschließend folgen wir, ganz wie gewohnt, Frankenstein in die Heimat, wo sein Bruder William ermordet und Justine Moritz beschuldigt wurde. Es kommt zur Konfrontation mit dem eigentlichen Mörder, der Kreatur, und schließlich zur Einwilligung Frankensteins, eine Frau für seine Schöpfung zu basteln. Das Ganze geht schief, das Monster tötet Frankensteins Braut Elisabeth und wird anschließend bis in den Polarkreis gejagt, wo dann die Rahmenhandlung einsetzt. So weit, so gewohnt, wie üblich liegt der Teufel in den Details. Die vielleicht größte Abweichung findet sich bei der Gefährtin für die Kreatur. Im Roman wie im Manga machen sich Victor und Henry Clerval gemeinsam auf die Reise nach Großbritannien, trennen sich dann aber und Victor beginnt alleine, an besagter zweiter Kreatur zu arbeiten, vollendet die Arbeit aber nicht und vernichtet sie, woraufhin die erzürnte Kreatur Henry tötet, der jedoch komplett unwissend bleibt. Im Manga hingegen kommt Henry seinem Freund auf die Spur, als dieser Leichenteile stiehlt. Victor gesteht ihm alles was geschehen ist, woraufhin Henry ihm sogar dabei hilft, sein Werk zu vollenden. Der Prozess gelingt – offenbar konnte auch Junji Ito sich der Sogwirkung des Universal-Klassikers „Bride of Frankenstein“ nicht entziehen, denn auch er lässt die „Braut“ erwachen und das ursprüngliche Monster zurückweisen, ganz so, wie es im Film geschieht. Es kommt zum Desaster, anders als die Boris-Karloff-Version der Figur gibt die Kreatur Frankenstein die Schuld, Henry Clerval stirbt ebenfalls und Ito kehrt quasi wieder zur Handlung des Romans zurück.
Generell interpretiert Ito die Kreatur deutlich negativer als die meisten anderen Adaptionen – oder gar der Roman selbst. Das beginnt bei der visuellen Gestaltung, denn hier lebt er sein Faible für grotesken Body-Horror aus. Itos Kreatur hat wirklich kaum Ähnlichkeit mit Boris Karloff und seinem viereckigen Schädel, aber auch die Beschreibung des Romans will nicht so recht mit seinem Design übereinstimmen. Zum einen ist die Kreatur wirklich absurd groß und zum anderen geprägt von den vielen verstörenden und ekligen Details, die Ito zu einem großartigen Horror-Künstler machen. Oft sind es bei seinen Wesen die Augen, die für den Terror verantwortlich sind – so auch hier. Die Handlungsänderung bei der Erschaffung der Braut sorgt zusätzlich dafür, dass die Kreatur an Sympathie verliert. Wo ihr Zorn im Roman durchaus als berechtigt wahrgenommen werden mag – schließlich bricht Frankenstein sein Versprechen – tötet sie hier die „Braut“ selbst, weil diese sie zurückweist, um anschließend Frankenstein die Schuld zu geben. Zudem ist der Umstand, dass die Kreatur Justine Moritz‘ Kopf zur Vollendung der „Braut“ beisteuert, eine zusätzliche Grausamkeit.
Eine weitere subtile Änderung findet sich am Ende: Als Frankenstein im Roman stirbt, kommt die Kreatur an Bord, schnappt sich den Leichnam und verschwindet mit ihm. Junji Ito lässt die die Kreatur hingegen nur aus der Ferne klagen, dass ihr Schöpfer nun von ihr gegangen ist. Wo im Roman ein gewisses Maß an Vergebung und sogar Kameradschaft impliziert wird, wirkt die Kreatur im Manga eher anklagend und geht ihrem finalen Schicksal schließlich alleine entgegen. Visuell ist Junji Itos „Frankenstein“ nach seinen Maßstäben relativ konventionell aufgebaut, sieht man von den oben beschriebenen Diskrepanzen ab. Itos filigraner Stil passt aber auch durchaus gut zu einer im Europa des 19. Jahrhunderts angesiedelten Geschichte. Und obwohl Frankenstein hier durchweg sehr jung erscheint, könnte man doch hin und wieder meinen, eine Spur Peter Cushings in seinen Zügen zu erkennen.
Fazit: Junji Ito kann auch „europäischen“ Horror. Seine Adaption von Mary Shelleys Frankenstein entspricht den hohen Qualitätsstandard des Mangaka und fällt im Großen und Ganzen auch ziemlich vorlagengetreu aus. Allerdings ist Itos Version von Frankensteins Monster nicht nur eine der furchterregendsten, sondern auch eine der negativsten Interpretationen.
Siehe auch:
Uzumaki: Spiral Into Horror
Hellstar Remina
Art of Adaptation: Frankenstein – Mary Shelleys Roman
Art of Adaptation: Universals Frankenstein
Art of Adaptation: Bride of Frankenstein
Art of Adaptation: Georges Bess’ Frankenstein