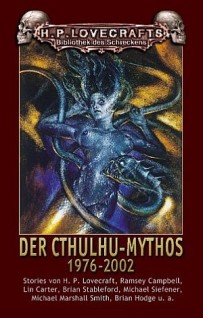Darth Maul gehört zu den Star-Wars-Figuren, die im Verlauf ihrer Existenz eine faszinierende Wandlung durchgemacht haben. Ursprünglich ersann George Lucas Maul für „Star Wars Episode I: The Phantom Menace“ als primärer, lichtschwertschwingender Widersacher der Helden und damit quasi als Ersatz für Darth Vader. Allein aufgrund seines Aussehens wusste Maul das Fandom für sich einzunehmen – und das, obwohl an der Charakterisierungsfront nun wirklich nicht viel passiert und Maul über kaum ein halbes Dutzend Dialogzeilen im Film verfügt. Aber Lucas und Team hatten bekanntermaßen schon immer ein Händchen dafür, visuell einprägsame Schurkenfiguren zu kreieren, die enorm beliebt werden; siehe Boba Fett. Nachdem Maul bereits in seinem ersten Film relativ unrühmlich abserviert wurde, schien es die Verantwortlichen bei Lucasfilm lange in den Fingern zu jucken, den gehörnten Sith-Lord auch in Geschichten, die nach „The Phantom Menace“ spielen, auftauchen zu lassen. Dies geschah in mehreren Comic-Kurzgeschichten, deren Kanon-Status selbst in der Legends-Koninuität bestenfalls wackelig ist. Unter anderem ließen die Comicautoren einen wohl mit Sith-Alchemie rekonstruierten Maul gegen Darth Vader antreten (in der Kurzgeschichte „Resurrection“ aus der Serie „Star Wars Tales“) und eine holographische Projektion durfte sich mit Luke messen (in „Phantom Menaces“, ebenfalls „Star Wars Tales“). Die Idee eines überlebenden Maul geisterte ebenfalls bereits seit 2005 durch den Äther – in der Geschichte „Old Wounds“, erschienen als Teil der Kurzgeschichtensammlung „Star Wars Visionaries“, die die Werke diverse Concept Artists von „Star Wars Episode III: Revenge of the Sith“ sammelt, konfrontiert Maul mit an General Grievous erinnernden Droidenbeinen einen gealterten Obi-Wan Kenobi auf Tatooine. Diese Story war definitiv nie Teil der Kontinuität, inspirierte aber zweifelsohne seine ersten Auftritte in „Star Wars: The Clone Wars“ und auch sein finales Schicksal in „Star Wars Rebels“.
Und damit wären wir auch schon bei der Crux der Sache, denn nicht nur kehrte Maul in der vierten Staffel von „The Clone Wars“ zurück, er schlug einen völlig neuen Pfad ein, versuchte sein eigenes Ding zu drehen, eroberte Mandalore, vereinte mehrfach diverse Verbrechersyndikate unter sich, überlebte bis in die Zeit des Imperiums und bekam in „Solo: A Star Wars Story“ sogar einen weiteren Realfilmauftritt. Der Maul, der schließlich in „Rebels“ und „Solo“ auftaucht, hat mit der ursprünglichen Inkarnation, die kaum mehr als ein Werkzeug Darth Sidious‘ war, nur noch wenig zu tun. Gerade in diesem Kontext ist es interessant, zu Mauls ursprünglicher Charakterisierung zurückzukehren – und wie ginge das besser als mit Michael Reaves‘ Roman „Darth Maul: Shadow Hunter“.
„Shadow Hunter“ knüpft inhaltlich direkt an die vierteilige Dark-Horse-Miniserie „Darth Maul“ von Texter Ron Marz und Zeichnerin Jan Duursema an. Nachdem Maul die Schwarze Sonne, das größte Verbrechersyndikat der Galaxis gnadenlos dezimiert hat, schickt Darth Sidious seinen Schüler auf eine neue Mission. Die Belagerung Naboos durch die Handelsföderation steht kurz bevor, doch Hath Monchar, einer der Neimoidianer, die das Konglomerat anführen, hat sich dazu entschlossen, diese Information an den Meistbietenden zu verhökern. Da dieser Umstand Sidious‘ Pläne empfindlich stören könnte, besonders, sollten die Informationen rund um die Blockade in die Hände der Jedi fallen, setzt er Maul auf Hath Monchar an. Dieser versucht derweil, besagte Informationen an den Mann zu bringen und findet in dem Informationshändler Lorn Pavan einen interessierten Käufer. Natürlich ahnt Pavan nicht, dass er sich damit ebenfalls zum Ziel Mauls macht. Maul selbst ist von dieser Mission nicht allzu angetan, da er sie als unter seiner Würde betrachtet, doch die Lage wird für ihn interessanter, als die Jedi Darsha Assant, eine Padawan kurz vor der Ritterprüfung, eher durch Zufall in die Situation verwickelt wird.
„Darth Maul: Shadow Hunter“ ist alles in allem eine verhältnismäßig kleine und begrenzte Geschichte. Schauplatz ist, von einigen Kontext-Szenen mit Nute Gunray und Co. einmal abgesehen, ausschließlich Coruscant, die Zahl der teilnehmenden Akteure ist ebenfalls sehr begrenzt und die gesamte Handlung nimmt auch relativ wenig Zeit in Anspruch. Beim Abfassen des Romans dürfte Michael Reaves vor den üblichen Problemen gestanden haben: Darth Maul, vor allem in seiner ursprünglichen Inkarnation, ist kein allzu ergiebiger Protagonist. Wo sich die Miniserie von Ron Marz und Jan Duursema auf die visuellen Aspekte und die Action konzentrieren kann, muss Reaves in größerem Ausmaß Innenleben und Dialoge liefern. Wie so häufig in Sith-zentrischen Romanen entschied sich Reaves, den eigentlichen Titelhelden bzw. -schurken Titelfigur zwar zu einer, aber nicht DER zentralen Figur zu machen. Ähnliches lässt sich auch in „Dark Lord: The Rise of Darth Vader“ von James Luceno oder „Darth Bane: Rule of Two“ von Drew Karpyshyn beobachten. Während wir als Leser durchaus Einblicke in Mauls Gedankenwelt bekommen, sind es doch eigentlich Lorn Pavan und Darsha Assant, zusammen mit dem Droiden I-5YQ, die die Handlung tragen, während Maul trotz allem die Antagonistenrolle innehat – zumindest in der zweiten Hälfte des Romans. Das Gegenbeispiel hierzu wäre Lucenos „Darth Plagueis“ – hier sind tatsächlich fast ausschließlich der titelgebende Dunkle Lord sowie Darth Sidious die Figuren, denen wir folgen.
Gemessen an der Begrenztheit der Handlung gelingt es Reaves trotzdem, einige interessante Fragen aufzuwerfen, auch wenn er sie vielleicht nicht mit der Ausführlichkeit behandeln kann, die sie verdienen. Zum einen gibt er zumindest ein paar Einblicke in die Gedankenwelt der Sith-Lords Maul und Sidious, ohne natürlich allzu sehr ins Detail gehen zu können. Bevor Episode III in die Kinos kam, war es im Expanded Universe Usus, Palpatine und Sidious als zwei unterschiedliche Figuren zu behandeln – da „Shadow Hunter“ 2001, also noch vor „Attack of the Clones“ erschien, fällt er genau in diese Ära. Interessanterweise bestätigt „Shadow Hunter“ aufgrund des Twists am Ende praktisch, dass Palpatine und Sidious dieselbe Person sind. Wer sich hier mehr Informationen über die Sith erhofft, wird wahrscheinlich enttäuscht, da Reaves kaum mehr als recht vage Andeutungen machen kann. Was die Charakterisierung Mauls angeht, hält sich Reaves klar an den damals herrschenden Standard, will heißen: Anders als die TCW-Inkarnation der Figur hat Maul hier keinerlei eigene Ambitionen, die über die Erfüllung der Pläne seines Meisters hinausgehen. Er verschwendet keinerlei Gedanken daran, eines Tages vielleicht gegen Sidious zu kämpfen, um ihm den Titel des Sith-Meisters abzuringen, wie es die Regel der Zwei verlangen würde. Wenn er versagt, erwartet er nicht nur eine Bestrafung, er ist der Meinung, jedwede Maßnahme, die Sidious für richtig hält, auch verdient zu haben. Die Idee, seinen Meister zu belügen, erscheint ihm völlig absurd. Dennoch ist Arroganz ein entscheidender Charakterzug, primär Arroganz gegenüber allem, was nicht Sith ist – also allem außer ihm selbst und Darth Sidious. Diese Arroganz und das damit verbundene Überlegenheitsgefühl verleiten Maul dazu, seine Gegner zu unterschätzen und Fehler zu machen. Hier knüpft Reaves schön an die Maul-Miniserie an, in der diese Thematik ebenfalls dominant ist. In „Darth Plagueis“ lässt James Luceno Sidious beide Einsätze entsprechend kommentieren.
Tatsächlich interessanter als Mauls Innenleben sind allerdings Lorn Pavan und Darsha Assant, weil sie im Grunde zwei Perspektiven auf den späten Jedi-Orden liefern, eine positive und eine ehr kritische. Lorn Pavan hat seine eigene Geschichte mit den Jedi, er war Angestellter im Tempel, als sich jedoch herausstellte, dass sein kleiner Sohn machtsensitiv ist, wurde dieser von den Jedi „eingezogen“ und Lorn Pavan wurde entlassen, um Bindungen zu vermeiden. Besagter Sohn, Jax Pavan, wird später übrigens Protagonist in diversen anderen Reaves-Romanen. Dementsprechend ist Lorn Pavan nicht allzu gut auf die Jedi zu sprechen. Für Darsha Assant hingegen sind die Jedi eine Ersatzfamilie, sie dominieren ihre ganze Welt. Beide lernen im Verlauf des Romans allerdings den Standpunkt des jeweils anderen kennen und ein Stück weit verstehen, wodurch sie einander schließlich auch Sympathie und Kameradschaft entgegenbringen. Das alles ist relativ knapp gehalten, funktioniert aber dennoch recht gut, da Reaves hier die Probleme, aber auch die Vorzüge des Jedi-Ordens als eine Art Mikrokosmos, heruntergebrochen auf zwei Individuen zeigt. Die ganze Angelegenheit besitzt zudem von Anfang an eine gewisse Tragik, da man als Leser natürlich weiß, dass die Schurken am Ende gewinnen müssen und Lorn und Darsha quasi zum Tode verurteilt sind.
Stilistisch sticht Reaves weder besonders positiv noch negativ aus der Masse der Star-Wars-Literatur heraus, „Darth Maul: Shadow Hunter“ ist flüssig, spannend und gut lesbar geschrieben, verfügt aber weder über den Detailreichtum eines James Luceno, noch über die Metapherndichte eines Matthew Stover. Reaves hat die Angewohnheit, immer wieder in die Köpfe seiner Charaktere zu blicken und uns an ihren inneren Prozessen teilhaben zu lassen, was meistens ganz gut funktioniert. Gerade bei Maul und Sidious fällt das mitunter etwas knapper und vager aus, was aber an den oben erwähnten Beschränkungen liegt, schließlich sollten viele Fragen, die „The Phantom Menace“ aufwarf, erst in den folgenden beiden Filmen oder sogar späteren Romanen beantwortet werden (Stichwort: „Darth Plagueis“). Wenn man Reaves etwas vorwerfen kann, dann ist es, dass hier vielleicht ein, zwei Mal zu häufig der Zufall bzw. Plot Convinience bemüht wird. Dieses Element kann man allerdings auch positiv bewerten, denn ausnahmsweise hilft die Plot Convinience nicht den Helden, sondern Sidious und Maul. Vielleicht ist die Macht bereits so im Ungleichgewicht zugunsten der Sith, dass jegliche Bemühungen schließlich und endlich zum Scheitern verurteilt sind. Wie man es jedoch auch dreht und wendet, dieser Umstand sorgt dafür, dass Maul weniger kompetent erscheint. Ein weiterer Kritikpunkt ist relativ typisch für Star-Wars-Literatur im Allgemeinen: War es wirklich nötig, Obi-Wan unbedingt einen kleinen Subplot zu verpassen und ihn so mehr oder weniger knapp an Maul vorbeischrammen zu lassen?
Im August 2022 erschien „Darth Maul: Shadow Hunter“ im Rahmen der „Essential Legends Collection“, was vor allem einen Vorteil hat: Zusätzlich zur gedruckten Neuauflage mit neuem Cover veröffentlichte man auch ein überfälliges, ungekürztes Hörbuch. Oft werden für diese Hörbücher Veteranen wie Marc Thompson oder Jonathan Davis herangezogen, hin und wieder wählt man allerdings auch besondere Interpreten. Für „Shadow Hunter“ verpflichtet man Sam Witwer, eine durchaus passende Wahl, gehören doch zu den Star-Wars-Charakteren, denen er seine Stimme lieh, neben dem Sohn aus der Mortis-Trilogie in „The Clone Wars“, Starkiller in den beiden Force-Unleashed-Spielen und Hugh Sion in „Star Wars: Resistance“ eben auch Sidious (in „The Force Unleashed“ und „Rebels“) und natürlich vor allem Maul („The Clone Wars“, „Rebels“ und „Solo: A Star Wars Story“). Dementsprechend lebhaft und stimmenreich ist Witwers Lesung des Romans. Vor allem sein Maul ist wirklich gelungen, seine Imitation von Liam Neeson (Qui-Gon hat ein, zwei kurze Gastauftritte) ist allerdings auch äußerst überzeugend. Mit seinem Palpatine/Darth Sidious hingegen bin ich nie so recht warm geworden. Witwers Auslegung der Figur war für mich immer ein wenig zu nah an der Parodie. Zudem basiert Witwers Sidious stark auf der Episode-VI-Inkarnation der Figur, während Ian McDiarmid den Imperator in Spee in „The Phantom Menace“ deutlich barscher und geschäftsmäßiger parlieren lässt. Trotz dieses kleinen Mankos ist die Lesung sehr zu empfehlen, vor allem, da Witwer in weitaus größerem Ausmaß mit dem Text mitgeht, als man das sonst vielleicht gewohnt ist und besonders in intensiven Szenen oder Passagen, die in die Gedankenwelt der Charaktere eintauchen, den Erzähler an die entsprechende Figur angleicht. Wer eine ruhigere, ebenmäßigere Lesung bevorzugt, wird damit wahrscheinlich nicht unbedingt glücklich werden, aber wer einem animierten, lebhaften Vortrag des Textes etwas abgewinnen kann, sollte sich das Hörbuch unbedingt zu Gemüte führen.
Fazit: „Darth Maul: Shadow Hunter“ ist ein sehr kurzweiliger, wenn auch in seiner Reichweite begrenzter Roman, der trotz seiner Kürze einige durchaus interessante Ideen vermittelt und einen interessanten Kontrast zum Maul der Disney-Ära schafft. Gerade als Hörbuch sehr empfehlenswert.
Siehe auch:
Darth Maul
Darth Maul: Son of Dathomir
Darth Plagueis
Solo: A Star Wars Story – Ausführliche Rezension